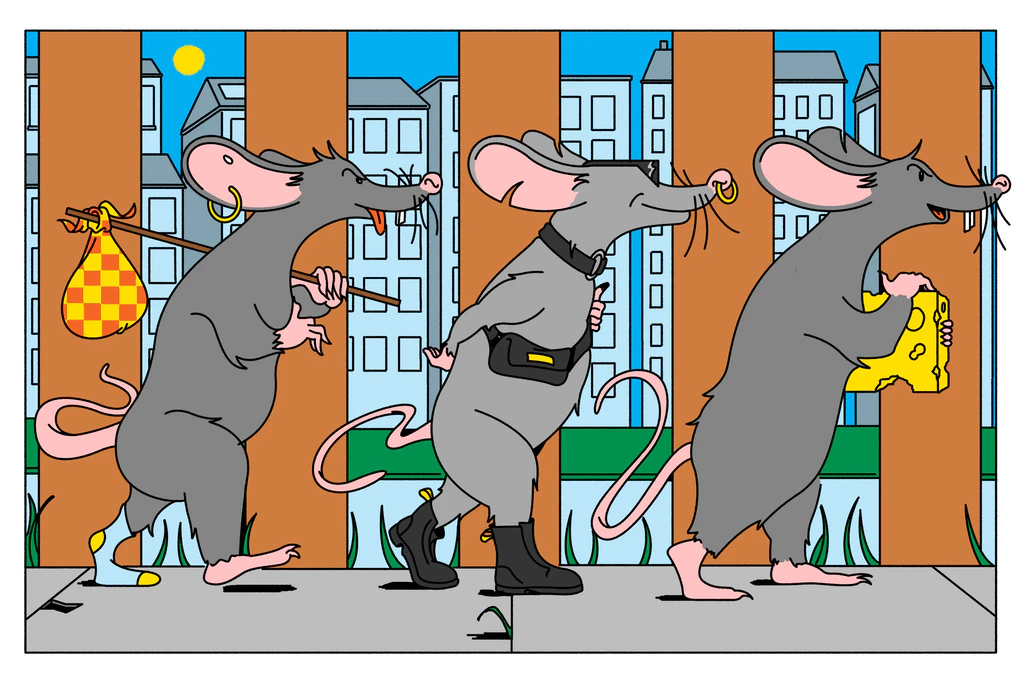Berlin – Der Mitteplatz heißt eigentlich nicht Mitteplatz. Aber die Anwohner nennen ihn so. Es ist einfach der Platz westlich der U-Bahnstation Gleisdreieck. An diesem Platz müssen alle vorbei, die von Ost nach West oder von Nord nach Süd wollen, von Schöneberg nach Kreuzberg, vom Potsdamer Platz zur Yorckstraße. Der Mitteplatz ist der Punkt, der mit einer rosafarbenen 1 eingezeichnet ist auf der Orientierungskarte, die überall im Park aufgestellt ist. In der Legende steht unter „1“: „Sport & Spiel“. Der gesamte Park wird auf der Karte ernsthaft „Oase“ genannt.
Vormittags um 11 Uhr: Drei Frauen schieben drei unterschiedlich große Kinderwagen vor sich her. Daneben machen vier Männer Burpees, eine Liegestütz-Luftsprung-Kombination. Ein weiterer steht daneben, hat die Hand in die nackten Hüften gestemmt, schaut schwitzend in den blauen Himmel. Ein Mittdreißiger in Baggyjeans fährt Longboard und zieht dabei einen Rollkoffer hinter sich her. Er findet das selbst so crazy, dass er mit der anderen Hand ein Selfie-Video dreht.
Zwölf Stunden später am selben Tag: Drei Jugendliche hören laut Rap-Musik. Sie singen jede Zeile mit und das einzige Wort, das sie deutlich gemeinsam rufen, ist „Nutte“. Immer sehr laut. Zwei Endzwanziger, Frau und Mann, in seltsam stylischen Klamotten drehen derweil ihre Runden mit ihrem Skateboard auf der Tartanbahn. Die Art, wie sie einander umkreisen, wirkt vertraut, sie sprechen nicht. Ein Polizeiauto fährt um 23.14 Uhr am Mitteplatz vorbei. Die Musik verstummt.
„Der Park am Gleisdreieck ist ein Kompromiss“, sagt Matthias Bauer. „Dieser Platz hier ist es auch.“ Mitteplatz, den Namen haben sich die Leute angewöhnt, die rings um den Park wohnen. Eben weil der Platz in der Parkmitte liegt. „Es ist ja auch schön, dass man den Namen selber entwickelt und dass der nicht irgendwo einfach dran steht.“ Die Wege haben hier auch keinen Namen. Über das „Sport & Spiel“ auf der Karte muss Matthias Bauer lachen. Es klingt etwas verbittert. Er zeigt auf einen der E-Scooter, die am Rand des Parks stehen. „Mit denen haben sie Jagd auf Fußgänger gemacht.“ Inzwischen haben die Betreiber wohl etwas unternommen gegen den Missbrauch der E-Roller. Ein paar Tage später dann: die Aktion mit den Feuerlöschern.
Bauer begann im Jahr 2009 das „Gleisdreieck-Blog“ zu betreiben. Darin werden Themen rund um die Entwicklung der inzwischen 35 Hektar großen Grünfläche besprochen. Wer im Blog liest, bekommt schnell das Gefühl, dass diese Gegend wie keine zweite Berlins Probleme und Trends zusammenführt: die Verdrängung von Alteingesessenen durch Neureiche, die Kämpfe der Fahrradfahrer gegen die Fußgänger und umgekehrt, die fehlende Rücksichtnahme älteren Leuten gegenüber, die kaum im Park zu sehen sind. Der Dreck, die Kulturunterschiede, das Bildungsproblem, die Flüchtlinge, der Fitnesswahn, die geschlossenen Schulen in der Pandemie, die verdammten Drogen. Auf alles das knallt gerade die Sommersonne und lässt es hier am Gleisdreieck umso greller erscheinen.
Aber zurück zu den Feuerlöschern. Anwohner sagen, Jugendliche hätten sie aus den Parkhäusern in der Nähe gestohlen. Im Internet gibt es Videos, die zeigen, wie jemand die Feuerlöscher auf Menschen richtet und unter Johlen „abdrückt“. „Gleisdreieck030“ hält es stolz für Instagram fest. Anfang April wurden so auch Polizisten angegriffen und in die Flucht geschlagen. Als Anwohner ein paar Tage danach die Polizei anriefen und sich wegen des Lärms beschweren wollten, dauerte es vier Stunden, bis die Beamten vom Abschnitt 52 am Platz waren. Später sagte ein Sprecher, dass sie erst eine Hundertschaft zusammenbekommen mussten, denn zwei Polizeistreifen beeindrucken niemandem am Gleisdreieck.
Fast 250-mal mussten die Polizisten des Abschnitts zu Einsätzen allein in diesem Jahr zum Gleisdreieck ausrücken, jeder fünfte Einsatz war wegen Lärmbelästigung. Immer wieder entdeckt die Polizei verbotene „Corona-Partys“. Ein sogenannter kriminalitätsbelasteter Ort, also eine Gegend mit einer besonderen Häufung an Straftaten, ist der Park dennoch nicht, sagt eine Polizeisprecherin. Neben der Lärmbelästigung und der damit verbundenen erhöhten Jugendkriminalität komme es im Park vor allem zu verschiedenen Raub- und sogenannten Rohheitsdelikten, also Körperverletzungen oder Nötigungen, auch: Vergewaltigungen.
Die Liste wird länger, je nachdem, mit wem man spricht. Da ist etwa Beate K. Seiferth, die seit 24 Jahren in diesem Kiez wohnt und vor ein paar Monaten eine Bürgerinitiative gegründet hat. Da ist Matthias Bauer, der in den 80er-Jahren gegen das hier geplante Autobahnkreuz demonstriert hat, dann Architektur studierte und sich seit Jahrzehnten mit diesem Park beschäftigt, um den sich jemand kümmern muss. Und da ist Kristiana Elig. Sie leitet ein Café am Rande des Parks, das so heißt wie jenes nachtaktive Tier, das den Kopf um 270 Grad drehen kann: Eule.
Das Café Eule liegt südlich vom Mitteplatz, inmitten einer kleinen Gruppe von Kleingärten. Am Rand stehen zwölf Rosenbüsche. Kristiana Elig hat jedes Mal einen gepflanzt, wenn ihr Café zerstört, in Brand gesetzt oder alle Stühle kaputt geschlagen wurden. „Klar hätte ich zumachen können“, sagt sie. „Aber dann hätten sie gewonnen.“ Sie, das sind diejenigen, die Koksspuren auf den Tischen hinterlassen, Uringestank in den Sträuchern oder wie neulich eine Blutlache. Fast 30-mal wurde eingebrochen in den neun Jahren, die es das Café Eule gibt. „Erst Anfang der Woche hat wieder jemand versucht, das Schloss aufzubrechen.“ Aber das hat Frau Elig inzwischen verstärken lassen, es gibt eine Alarmanlage. Was sie nicht sein will: ein Opfer.
Die 48-Jährige hat zwei Kinder und bis vor ein paar Jahren Reportagen für das ZDF gedreht. Dann kam die Idee für das Café im Park, der noch nicht mal fertig war. Im Herbst 2011 wurde der Ostteil des Parks eröffnet, drei Jahre später der Westteil. Damals galt der Park als der einzige Park Berlins ohne Dealer. Es dauerte, bis sich Menschen auf den Wiesen niederließen, zu neu wirkte alles. Die Stadt fremdelte eine Weile mit dieser seltsamen Fläche, die aus der Luft betrachtet aussieht wie jener gezackte Pfeil, der auf Stromkästen vor Hochspannung warnt. Dann kam das erste Graffiti, die erste zersprungene Flasche, die erste Spritze im Sandkasten.
Matthias Bauer ist schon durch den Park gelaufen, als der noch umzäuntes Bahngelände war. „In den 70er-Jahren war hier ein Autobahnkreuz geplant“, sagt er, „das kann man sich heute nicht mehr vorstellen.“ Aber damals stand die Mauer noch und das hier war eine Brache. Heute treffen sich im Park die Bezirke Mitte, Schöneberg und Kreuzberg, das macht die Frage der Zuständigkeit nicht einfacher. Bauer zeigt auf die neuen Gebäude, die gerade neben dem Mitteplatz gebaut werden. „Im FNP ist diese Fläche noch als Grünfläche markiert.“ FNP steht für Flächennutzungsplan. Jetzt entsteht hier ein S-förmiges Gebäude. „Und warum diese Form?“, fragt er und antwortet gleich selbst: „Damit für noch mehr Wohnungen das Argument Parkblick gelten kann.“
Bauer hat nichts gegen Neubauten. Aber er findet es problematisch, dass hier falsche Erwartungen geweckt werden. So ist es schon am Mauerpark in Prenzlauer Berg oder an den Luxusbauten am Friedrichshain oder am Teutoburger Platz gewesen. Da kosten 70 Quadratmeter so viel wie eine kleine Stadtvilla an der Stadtgrenze zu Brandenburg – und manche bezahlen es trotzdem. Und dann wundern sich die Erstbezügler, dass der nahe gelegene U-Bahnhof Yorckstraße ausgerechnet der hässlichste der Stadt ist und dass gleich neben dem Park etwas beginnt, das die Alteingesessenen ganz nonchalant „Babystrich“ nennen und dann schnell das Thema wechseln.
Beate K. Seiferth ist vor einem Vierteljahrhundert in eine der Sozialwohnungen am Park gezogen. Wenn sie auf einer Skala von 1 bis 10 beschreiben soll, wie sich die gefühlte Bedrohungslage verändert habe in ihrem Wohnviertel, sagt sie: „Als der Park eröffnet wurde, war es ganz klar eine Null — und aktuell ist es eindeutig eine 15.“ Sie sagt, die Partys gehen am Wochenende teilweise bis 7 Uhr morgens, Technomusik, Rap, dunkle Bässe. „Am Anfang bin ich noch selbst hin und hab‘ um Ruhe gebeten“, sagt die 60-Jährige. „Aber bis ich bei meiner Wohnung ankam, war es schon wieder laut.“ Neulich wurde sie mit einer Bierflasche bedroht, als sie um Ruhe bat. Seitdem ruft sie nur noch die Polizei. „Vor ein paar Tagen kam noch eine Vergewaltigung hinzu“, sagt sie, „und jedes Wochenende macht dieser Park einer Müllkippe Konkurrenz.“
Im Spät-Frühsommer 2020 wurde es Seiferth zu viel. Sie druckte A4-Flyer, auf denen dreimal groß stand: „Schluss mit Ballermann am Gleisdreieckpark!!!“ Wobei Ballermann es nicht richtig trifft. Wer an Ballermann denkt, dem fallen nicht Kot und Ratten auf Spielplätzen ein, oder Spritzen, die in Baumstämmen stecken, benutzte Tampons und Kondome in den Büschen. Plus der entsprechende Geruch. Diese Streifen-Flyer klebte sie an Türen im Kiez und forderte einen runden Tisch. Rund 40 bis 50 Menschen trafen sich zu einem ersten Treffen auf den Plastikstühlen im Café Eule, alle hatten eine Horrorgeschichte parat. Ein paar Wochen später gründete sich die Bürgerinitiative Gemeinsam fürs Grüne Gleisdreieck.
Zum Beispiel die Geschichte, die Beate K. Seiferth erlebt hat: „Da gehe ich den Weg durch den Westteil des Parks zwischen U1 und U2 vorbei, dort stehen mehrere Jugendliche, die ganz aufgeregt sind, weil einer von ihnen am Boden liegt. Sie bitten mich inständig, die Polizei zu rufen. Sie hätten kein Handy. Als doch eines aus der Tasche eines der Jungs herausschaut, werde ich misstrauisch. Offenbar wollten sie unsere Handys abziehen. Zum Glück war ich nicht allein, wir sind weiter, der Junge am Boden stand längst wieder auf, sie warteten auf das nächste Opfer.“
Aus dem ersten Anwohnertreffen hätte eine große Bürgerbewegung werden können, wären Demonstrationen, vielleicht ein gemeinsames Sit-in im Park gefolgt. Aber weil die Stadt, das Land und der Planet von einem Virus heimgesucht wurden, kann Beate K. Seiferth sich an fünf Zoom-Sitzungen erinnern. „Herausgekommen ist“, sagt sie, „dass es jetzt zwei große Mülleimer im Park gibt.“
Die von den Architekten für diesen Park designten Mülleimer haben nur kleine Löcher, da passen keine Pizzakartons hinein. Sonst änderte sich wenig. Und dann ging eben im Frühjahr 2021 die Sache mit den E-Scootern und den Feuerlöschern los. Wieder trafen sich die Bürger und beratschlagten. „Ich hätte nie gedacht“, sagt Beate Seiferth, „dass ich einmal mehr Polizeipräsenz möchte.“ Aber es gehe nicht anders.
Matthias Bauer weiß um diese Probleme und er moderiert Streitgespräche dazu in seinem Blog. Neulich wurde eine Mauer im Park aufgebaut. Die BVG hat unter dem Viadukt Absperrungen errichten lassen. „Der Bau steht unter Denkmalschutz“, sagt Bauer, „und ist über 100 Jahre alt.“ Er soll irgendwann erneuert werden, aber wahrscheinlich gehe es auch darum, sagt er, mit der Sanierung schon mal offiziell zu beginnen, bevor sie durch andere Neubauten kompliziert wird. Für Graffitikünstler ist das eine willkommene Aufforderung. „Aber es ist auch ein Freiraum weniger für das Auge“, sagt Bauer. „Andererseits weiß man im Park am Gleisdreieck immer, dass man in einer Großstadt ist.“
Im östlichen Teil des Parks, der im Herbst zehnjähriges Jubiläum feiert, sind die Probleme ähnlich. Gesäubert wird der Park so gut es geht von der Firma Grün Berlin, aber im Jahr 2020 erhöhten sich die Kosten für die Reinigung von rund 230.000 Euro um rund die Hälfte. Zu häufig war es zu mutwilliger Zerstörung gekommen. Auf Anfrage sagt eine Sprecherin von Grün Berlin: „Wir beseitigen die Müllberge täglich – jeden Morgen.“ An einigen Orten der Parkanlage wurden zusätzliche Abfallbehälter installiert. „Die werden bisher gut angenommen, jedoch auch für die Entsorgung von Haus- und Sperrmüll genutzt.“ Weitere Behälter sollen folgen.
Wer diesen Park im Juni 2021 besucht, der trifft ähnlich wie im Westteil viele Sportler, ein paar Hip-Hop-Tänzer, und hört den Satz: „Wo wollen wir es machen?“ Und die passende Antwort: „Warte, hier schauen zu viele zu.“ Dieser ungelenke Dialog zwischen Dealer und Käufer ist auch am Tag zu hören. Abends dann Jugendliche in Gruppen, die um eine kleine USB-Box sitzen. Einer macht ein Foto von seinen Schuhen im Gras. Dann zoomt er ganz nah ran: noch ein Foto. Dann gibt sein Nachbar ihm den Joint.
„Am Wochenende“, sagt Joye, 20, „sind es zehnmal so viele.“ Der gebürtige Berliner wohnt in Wedding, studiert Politik an der Freien Universität und „hängt hier oft ab“, wie er sagt. Er hat gerade Besuch aus Frankreich. „Wo sollen wir sonst hin?“ Die Clubs haben zwar gerade wieder aufgemacht, aber er sagt voraus, dass es noch eine Weile dauern wird – weil diese Art des Feierns auch günstiger sei. Bier oder Sekt vom Späti – und viele andere im gleichen Alter. „Da lohnt sich die Herfahrt.“
Das ist ein Satz, den man oft hört von jungen Erwachsenen, die außerhalb des Rings wohnen, in Pankow, in Friedenau, aber hier feiern oder Volleyball spielen. Sport & Spiel eben. Dann eine Zigarette rauchen und sie fallen lassen.
Grün Berlin hat im Ostteil des Parks einen riesigen Zigarettenstummel aufgestellt. Der soll die Parkbesucher daran erinnern, dass sie ihren Müll wieder mitnehmen. Funktioniert hat das bisher nicht. Sobald es dunkel wird, ist nicht mehr genau auszumachen, ob der Schatten, der sich gerade im Busch bewegt hat, ein Fuchs, ein Kaninchen oder eine Ratte ist. Nicht alle Scherben kann Grün Berlin von der Wiese aufsammeln. Auf die Frage, ob sie überfordert sind, antwortet die Sprecherin: „Wir erfüllen unsere Aufgaben in der Bewirtschaftung und Pflege der Anlagen vollumfänglich.“ Und selbst die kritischsten Anwohner sagen: Ab acht Uhr ist es meistens sauber.
Doch langsam bewegt sich auch einiges auf politischer Seite. Mehrere Anträge sind in die BVV eingegangen und werden wohl noch diesen Sommer umgesetzt: Die FDP will Parknutzer mit Flyern über ihre Pflichten informieren. Vier Toilettenanlagen sollen installiert werden. Die liberale Partei bringt auch eine Umzäunung ins Spiel. Nach 22 Uhr wäre dann Schluss im Park. Klaus Lederer (Linke) hatte dagegen verkünden lassen, dass er einen „Sommer der Ermöglichung“ möchte, in dem Menschen einander begegnen.
Und die Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann (Grüne) sagt: „Ich wünsche mir für alle Grünorte, ob Parks oder Spielplätze, dass sie wieder Orte mit positiver Aufenthaltsqualität werden. Und ich wünsche mir, dass die Menschen endlich ihre Verantwortung für die Gemeinwesenflächen übernehmen und dieser unerträgliche Egoismus aufhört.“ Fernab solcher Worte möchte sie durchsetzen, dass tagsüber und abends Ordnungskräfte vor Ort sind. So sollen Situationen erst gar nicht entstehen, die eine polizeiliche Unterstützung nötig machen.
Kristiana Elig vom Café Eule würde sich zumindest über mehr Engagement von politischer Seite freuen. Sie hat am Montag dem Innensenator Andreas Geisel eine E-Mail geschrieben. Seitdem ist es spürbar ruhiger. „Bei mir ist sowieso Scooter-Verbot“, sagt sie, „das darf ich durchsetzen, ich hab das Hausrecht.“ Wie das Wochenende wird, wagt sie nicht vorauszusagen. Sie bleibt dabei: „Der Park ist übernutzt.“
Beate K. Seiferth wird sich weiter einsetzen für mehr Ruhe, weniger Vandalismus und Abfall im Park. „Es gibt manchmal total nette Momente im Park“, sagt sie. Tagsüber hat sie einen schönen Blick in die Baumkronen. „Schon ein großer Luxus.“ Neulich hat ihr einer der Partypeople, wie sie die Feiernden nennt, zugerufen: „Was ziehst du auch an einen Park. Dann zieh doch weg.“ Sie hat gesagt: „Ich war hier, als es den Park noch gar nicht gab.“
Migranten engagieren sich leider selten in Initiativen
Und Matthias Bauer hat ein neues Thema gefunden, um das er sich kümmert. Am Rande des Westparks, auf einem 500 Meter langen Grundstück, planen Investoren sieben Hochhäuser, zwischen 60 und 90 Meter hoch. „Urbane Mitte“ heißt das. Aber Bauer hat gemerkt, dass sich sein Engagement gelohnt hat. Ohne Menschen wie ihn sähe es jetzt anders aus an diesem Park. Dann hätten die Stadtdesigner, die „Sport & Spiel“, „Strand & Sitztribüne“ sowie „Naturerfahrungsraum“ als ein ernsthaftes Freizeitangebot für Berliner Jugendliche verstehen, vielleicht gewonnen. „Denn das war doch das besondere hier, an diesem Park“, sagt Bauer, „dass die Natur sich den Platz zurückerobert hatte.“
Er findet das erhaltenswert, weil sich nur so Stadtgeschichte erklären lässt. Dieser Park, der bis zum Zweiten Weltkrieg nur ein Güterbahnhof war und in dem dann ein Fußballplatz nach Fifa-Regeln entstehen sollte. Bauer: „Wurde dann zum Glück nicht gebaut.“ Gegen die geplanten Hochhäuser am Gleisdreieck formierten sich inzwischen elf Initiativen. Bauer fiel dabei etwas auf: „Es waren kaum Migranten und kaum junge Menschen unter denen, die sich engagierten.“ Er hofft, das ändert sich. Denn das war ja mal seine Idee, der Park für alle.
Mitarbeit: Maxi Beigang
Erschienen in der Berliner Zeitung, 19.6.2021.