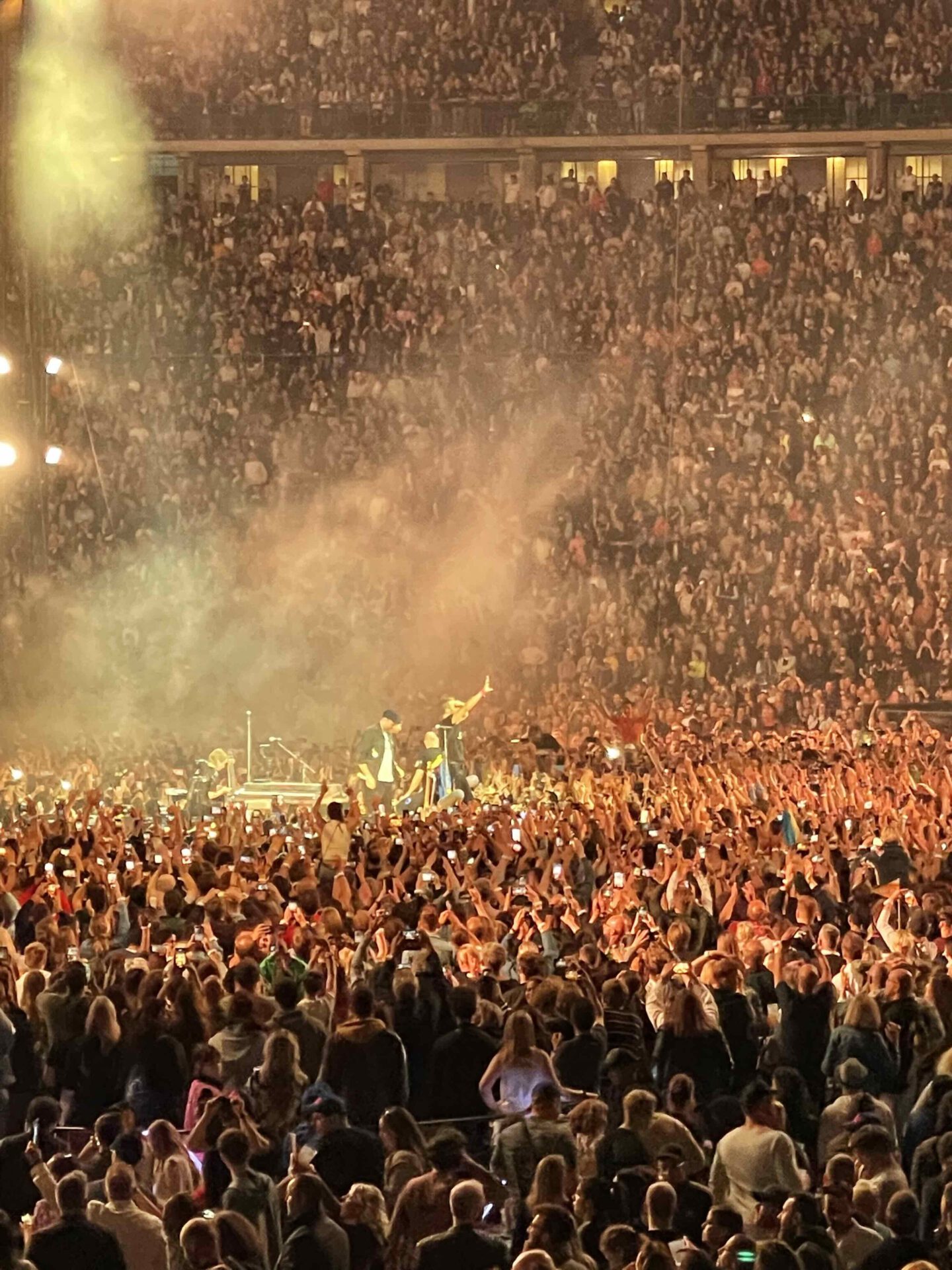Als Patrick Ray gegen 20 Uhr aus der U6 in Seoul an der Station Itaewon steigt, hat er sofort das Gefühl, dass hier etwas nicht stimmt. „Itaewon ist einfach jedes Halloween der Ort, an dem alle sind“, sagt er, „aber so voll habe ich es noch nie erlebt.“ Seit fünf Jahren wohnt der Amerikaner in Seoul. Es gibt eine Schlange von Menschen vor der ersten Treppe, eine weitere an der Rolltreppe und oben am Ausgang noch einmal. „Es hat eine halbe Stunde gedauert, aus der U-Bahn auf die Straße zu kommen“, sagt Patrick Ray. Als sie auf der Straße ankommen, wird es aber nicht besser, sondern schlimmer. „Wir standen Ellbogen an Ellbogen.“
Nur zwei Stunden später kommt es gleich neben dieser U-Bahn-Station zu einer Massenpanik, bei der 151 Menschen sterben, mindestens 82 verletzt werden, die meisten der Opfer sind jünger als 30 Jahre. Es ist noch nicht klar, was die Panik auslöst, aber alles deutet derzeit darauf hin, dass in einer engen Seitengasse der Druck auf die Menge so groß ist, dass einige Menschen stürzen und andere auf sie fallen und es kein Zurück mehr gibt. Unter den Opfern waren nach bisherigen Meldungen 19 Nicht-Koreaner, darunter Menschen aus China, Norwegen, Usbekistan und Iran.
Die ersten Notärzte wurden kurz nach 21 Uhr gerufen, doch auch sie kamen nicht durch die Menge von Menschen und Autos. Das Halloween-Fest in Itaewon gilt als der Höhepunkt des Spätsommers in diesem Stadtteil. In früheren Jahren kamen rund 20.000 bis 30.000 Menschen zu diesem Festival. In den vergangenen beiden Jahren fand das Fest nur stark eingeschränkt statt. Wohl auch deshalb kamen in diesem Jahr schätzungsweise 100.000 Menschen nach Itaewon, um hier zu feiern. Außerdem wurde während der Pandemie der Bezirk durch die Netflix-Serie „Itaewon Class“ sehr bekannt, was sicherlich zusätzlich Gäste anzog.
Einer davon ist der Indonesier Beta Bayusantika. Der 27-Jährige wollte unbedingt einmal Halloween in diesem Stadtteil feiern. Als er zwischen 21 und 22 Uhr an der Station ankam, war es schon zu voll, um in die bekannte Party-Straße hinter dem Hotel Hamilton einzubiegen. „Ich konnte sehen, dass die Menschen Schwierigkeiten hatten, von dort herauszukommen“, sagt er. „Dann hörte ich nur noch Hilferufe auf Koreanisch. Und kurz darauf sah er Menschen auf der Straße liegen, die noch im Kostüm waren, die von anderen Menschen in Kostüm mit Herzmassage versucht wurden wiederzubeleben.
Das sind die Videos, die am Sonntagmorgen in der ganzen Welt für Aufmerksamkeit sorgen: die Straßen, in denen nebeneinander Leichen liegen, die nur notdürftig mit Folie abgedeckt wurden; die Menschen, die in der Seitenstraße neben dem Hotel Hamilton aneinandergedrückt werden und Schreie ausstoßen; die verzweifelten Versuche von mehreren Ärzten, Menschen zurück ins Leben zu holen.
Für Patrick Ray ist das am folgenden Tag ein Bild, das er nie vergessen wird. „Ich habe noch nie in meinem Leben Tote gesehen“, sagt er. „Aber als ich sehe, wie dort Menschen auf dem Boden liegen und beatmet werden, ist mir klar, dass wir diesen Ort so schnell wie möglich verlassen müssen.“ Schon vorher habe er gemerkt, dass sie für eine Strecke, die er sonst in zwei Minuten laufen kann, 20 Minuten brauchten. Als er sieht, dass die Lage eskaliert, begibt er sich sofort wieder zur U-Bahn und schafft es gerade noch in die letzte U-Bahn, bevor der öffentliche Verkehr eingestellt wird.
Itaewon ist eine in Südkorea berühmte Gegend, auch berüchtigt. Jahrzehntelang war der Stadtteil vor allem für die US-Soldaten berühmt, die hier ihre Basis hatten, die größte außerhalb der USA. Mehr als 20.000 Soldaten waren dort zwischen 1945 und 2019 stationiert. Die Basis wurde dort aufgebaut zu einer Zeit, als Seoul noch viel kleiner war und Itaewon außerhalb der Innenstadt lag. Hier waren schon die Japaner stationiert, als sie 1910 Südkorea kolonisierten. Innerhalb der Mauern entstand eine Art Mini-USA mit kleinen Straßen und Geschäften.
Als die USA mit Südkorea 2019 übereinkamen, die Basis außerhalb von Seoul zu errichten, veränderte sich der Stadtteil und öffnete sich zunehmend für Koreaner. Bis dahin war Itaewon der Bezirk, in dem vor allem Nicht-Koreaner wohnten. Es gab türkische, italienische und deutsche Restaurants, beliebte Ausflugsziele für Koreaner, die einmal etwas Exotisches probieren wollten. Rund um die Basis hatte sich auch ein Nachtleben entwickelt, das es sonst in Seoul nicht gibt: Bars für Homosexuelle und Transpersonen, aber seit neuestem auch immer mehr Craftbeer-Bars. Itaewon wurde der Bezirk zum Ausgehen für lange Wochenenden.
Einer, der davon profitiert hat, ist Park Tae-eung. Der 46 Jahre alte Koreaner ist Inhaber mehrerer Restaurants im Stadtbezirk. Zum Zeitpunkt der Massenpanik war er in einem Restaurant, das erst vor drei Wochen eröffnet wurde. „Von oben habe ich nur gesehen“, sagt er der Berliner Zeitung, „dass es immer mehr Menschen wurden“. Er habe sich noch gewundert, dass er nicht so viel Polizisten sieht wie in den Jahren zuvor. Am Morgen fragte er deshalb einen befreundeten Polizisten, ob es wirklich weniger waren. „Er sagte, es waren weniger Polizisten eingeteilt als in früheren Jahren.“
Das deckt sich mit den Informationen der New York Times vom Sonntagmorgen. Die Polizei sei überfordert gewesen mit den Massen an Menschen und habe sie nicht kontrollieren können. Berichte, nach denen die Sichtung eines berühmten K-Pop-Stars die Panik ausgelöst habe, konnten bisher nicht bestätigt werden. Auch die Gerüchte im Netz, dass Drogen eine Rolle gespielt haben sollen, blieben bisher unbestätigt. Angesichts der sehr strengen Anti-Drogen-Gesetze in Korea und der geringen Verbreitung harter Drogen im Land ist das jedoch unwahrscheinlich.