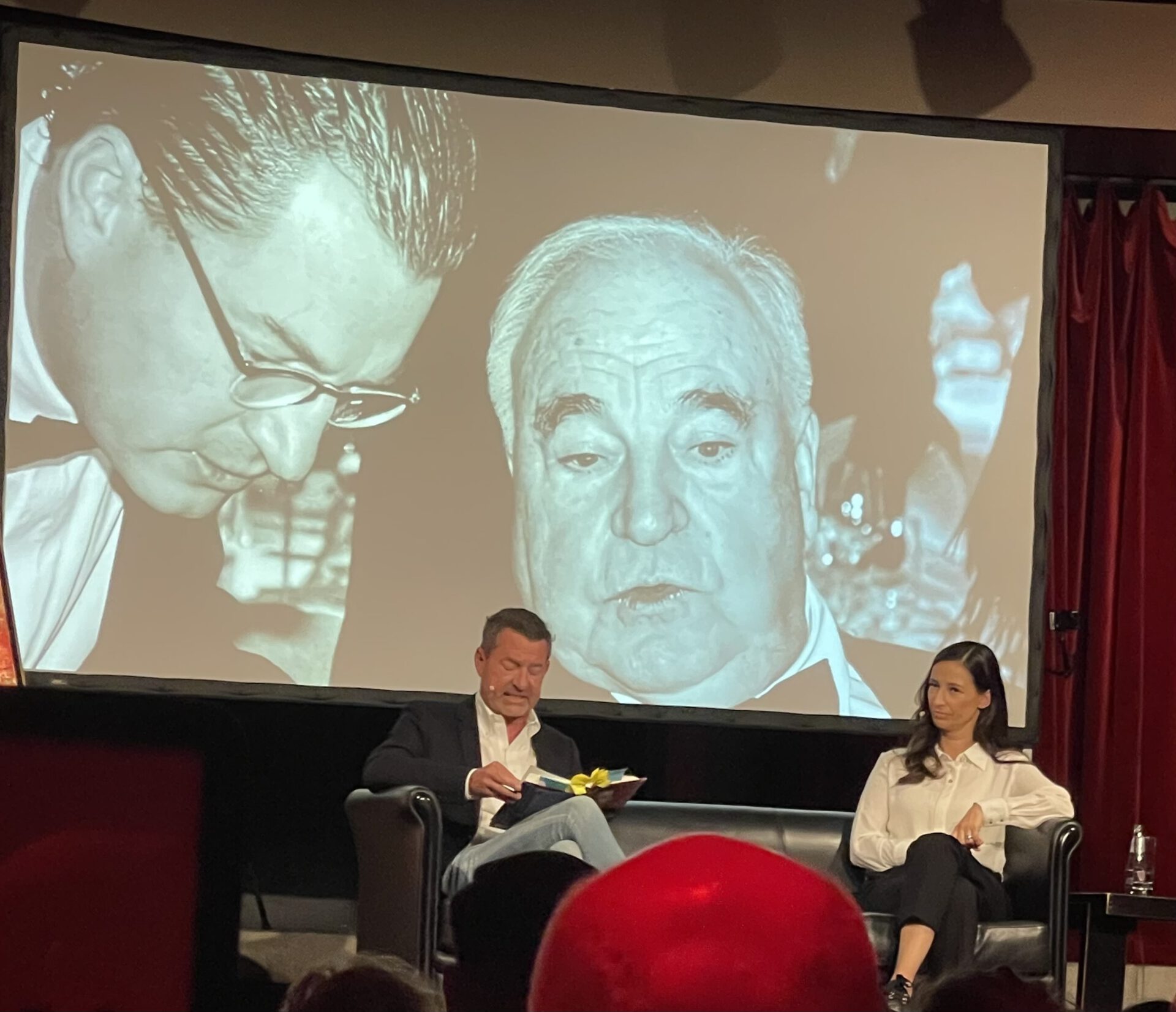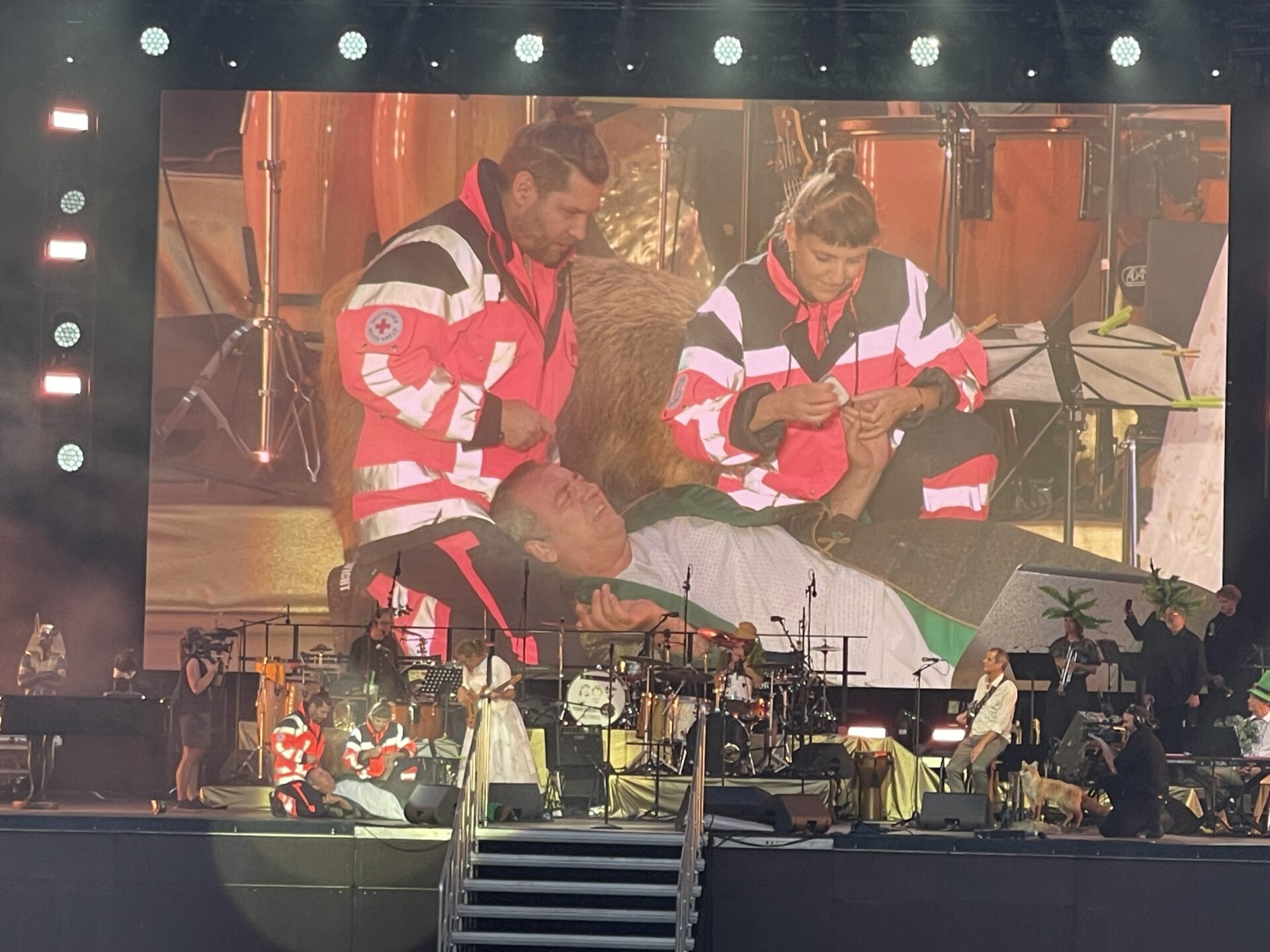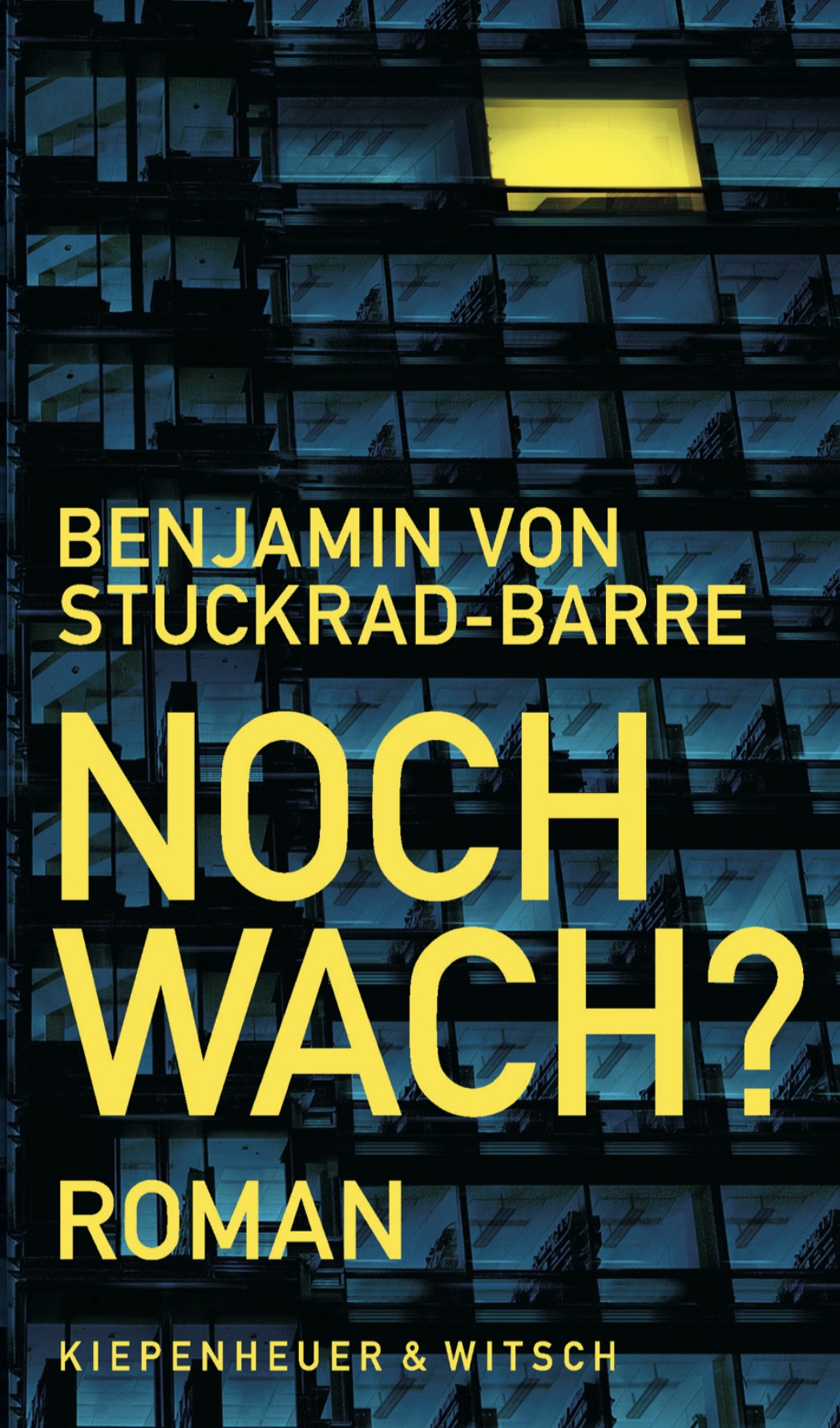Seit 15 Jahren schickt die amerikanische Dragqueen RuPaul eine Gruppe von Nachwuchsdiven in den Kampf: Sie müssen singen, tanzen und vor allem schlagfertig sein. Die Show war in den vergangenen Jahren auch in Spanien, Frankreich und sogar auf den Philippinen zu sehen. Am Dienstag wird die erste Folge des deutschen Ablegers „Drag Race Germany“ beim Streamingdienst Paramount+ laufen. Streng genommen ist es „Drag Race DACH“, weil auch Österreich und die Schweiz jeweils zwei Kandidatinnen ins Rennen schicken. Zu gewinnen gibt es 100.000 Euro. Die Show wird moderiert von der Berliner Dragqueen Barbie Breakout und Gianni Jovanovic, die zusammen mit Dianne Brill die Jury bilden.
Nikita Vegaz ist eine von zwei Berliner Kandidatinnen, die um die Krone bei Drag Race kämpfen. Sie kommt zusammen mit der Drag-Race-Moderatorin Barbie Breakout ungeschminkt zum Interview auf das Dach des Berliner Verlags. Einer der beiden kennt diesen Blick schon, weil er mal ein Date im Nachbarhaus hatte. Doch heute soll es um die erste Staffel von „Drag Race“ gehen, auch wenn sie nur wenig verraten dürfen.
Berliner Zeitung: Barbie, Nikita, wie begann eure Reise zu „Drag Race Germany“?
Nikita: Im September kam die Casting-Ausschreibung. Ich dachte schon immer, dass ich ganz gut bin. Ich habe dann Barbie gefragt, ob ich mich bewerben solle. Und sie meinte: „Ja, mach das auf jeden Fall!“ Dann hab ich mein Bewerbungsvideo schnell zusammengeschnitten und abgeschickt. Irgendwann kam noch eine Nachfrage, dann wieder lange nichts – und dann die Zusage.
Barbie: Als Nikita mich anschrieb, war ich als Host noch nicht mal angefragt. Nur dass es da keine Missverständnisse gibt! Im Jahr 2013 hat schon mal eine Münchener Filmfirma die Lizenz für „Drag Race Germany“ gekauft, und auch damals war ich schon mal als eine mögliche Hostess im Gespräch. Aber wie wir wissen, ist es ja damals nichts geworden. Aber in den zehn Jahren danach habe ich immer, wenn ich mit TV-Leuten zu tun hatte, das Thema gepusht. Und dann gab es ja die erste Version mit Conchita und Heidi Klum, die ja etwas Ähnliches wie „Drag Race“ versuchte.
So schlecht waren die Kritiken jetzt nicht.
Nikita: Für den ersten Versuch war es schon okay.
Barbie: Trotzdem war ich dann doch sehr aufgeregt, als es hieß, „Drag Race“ kommt nach Deutschland. Ich hatte für mich schon eine Rolle darin gesehen, aber bestenfalls als Jury-Mitglied. Aber dieser Anruf kam nie. Und dann waren die Castings schon vorbei, die Queens standen fest, und ich hatte noch immer nichts gehört! Ich dachte: Okay, dann soll es nicht sein. Erst kurz danach kam dann doch eine E-Mail mit der Bitte, ob ich nicht am nächsten Tag Zeit hätte für ein Gespräch.
Wie seht ihr die Rolle von „Drag Race“ in der queeren Community? Kann die deutsche Staffel dem noch etwas hinzufügen?
Barbie: Also für mich ist das wirklich so ein bisschen wie der queere Superbowl, ein Ereignis, das die Community zusammenbringt. Aber „Drag Race“ hat darüber hinaus vielleicht sogar noch eine nicht ganz so offensichtliche Wirkung, ohne es vielleicht direkt darauf angelegt zu haben: Die Show hat Drag in den Mainstream geholt, raus aus der Bar, rein in die Wohnzimmer von Otto-Normalzuschauer:innen. Die Leute sehen plötzlich, dass wir ganz „normale“ Menschen sind, die „normale“ Geschichten haben, dass man sich auch mit uns identifizieren kann, ohne jetzt wahnsinnig queer sein zu müssen – und dass wir vor allem keine Bedrohung sind.
Braucht man dafür eine Krone am Ende und diese ganzen Streitereien? Es wird ja oft kritisiert, dass es mehr um die Streitereien geht als um den Drag.
Nikita: Bei uns ist es nicht so. Wir sind auf jeden Fall ein bisschen liebevoller miteinander. Ich finde, es wird von Staffel zu Staffel familiärer, auch in den US-Folgen.
Hast du alle amerikanischen Staffeln gesehen?
Nikita: Ja, alle 15 amerikanischen Staffeln – und ich fand es einfach geil. Ich habe mich auch über diese Sendung in dieses Drag-Leben reingefuchst und irgendwann hatte fast alles in meinem Leben mit Drag zu tun. Ich habe schon früh angefangen, mein ganzes Geld für Drag auszugeben. Alle drei Jahre eine neue Jeanshose, das musste reichen – und alles andere Geld ging für meinen Lebensstil drauf, also ja, auch für mich.
Hat dieser Spaß an der Verwandlung bei euch schon als Kinder angefangen?
Nikita: Es gibt sogar noch Fotos, auf denen ich schon als Kind an Karneval als Frau gegangen bin, und ich glaube, meine Schwester als Mann. Aber ich sah ganz schlimm aus, ein hässliches Kleid und ein alter Hut. Ich habe ja damals noch auf Rügen gelebt und erst in Berlin habe ich das erste Mal richtig Drag gesehen, zum CSD natürlich. Das war mit Stefanie Deluxe, alte GMF-Zeiten, bei der hab ich gewohnt. Kennst du sie?
Barbie: Ja, na klar!
Nikita: Ach so, ja, und ich habe mich dann zum ersten Mal als Frau angezogen. Ich weiß noch, wie Stefanie sagte: „Liebling, den Lidstrich, den mach ich mal lieber, das wirst du niemals können.“ Und dann war ich das erste Mal richtig Dragqueen.
Mir fällt auf, dass ihr sehr viele englische Begriffe verwendet im Gespräch. Ist das bei der Show genauso?
Barbie: Also ich spreche ja ohnehin auch in meinem Alltag fließend Denglish. Und bei „Drag Race“ geriet das natürlich ein bisschen außer Kontrolle. Alle Sätze, die wir aus dem Original im Kopf haben, die zur Sendung gehören, sind natürlich auf Englisch. Keiner von uns guckt das ja auf Deutsch. Und dann sitzt in der Sendung Dianne neben mir, mit der ich sowieso immer Englisch rede. Das hat es schon sehr schwer gemacht, nicht in jedem Satz irgendwelche Anglizismen zu verwenden.
Übernimmst du auch die englischen Begriffe wie „bring back my girls“?
Barbie: Ich habe das übersetzt, was Sinn macht zu übersetzen, und ich hab die Sachen so gelassen, bei denen das besser passte.
Dafür wird auch viel Dialekt und Akzent gesprochen.
Nikita: Ich konnte früher noch Plattdeutsch. Aber wenn du 20 Jahre in Berlin wohnst, dann klingst du anders. Wenn ich eine Woche lang wieder oben auf Rügen bin, dann kriege ich den Dialekt sofort wieder.
Barbie: Ja, man darf auch gar nicht vergessen, dass nicht nur Deutschland mitspielt, sondern auch Österreich und die Schweiz. Wir haben echt tolle Queens aus beiden Ländern dabei, und auch sonst haben wir versucht, den Cast so divers zu machen, wie unsere Länder es sind. Und dann war da echt ein Sammelsurium von wirklich wunderbaren Queens aus ganz unterschiedlichen Ecken der Welt, die eben Deutsch sprechen. Also ich habe es sehr genossen, überrascht, wie kreativ unser Drag mittlerweile ist. Obwohl es aus Deutschland kommt.
Können wir mithalten mit dem Original?
Barbie: Ich war wirklich überrascht davon, was für ein Level an Professionalität, Glamour und Talent einfach am Start war. Ich war wirklich von den Socken am ersten Tag. Ich bin da rein und wusste vorher nicht, wer kommt. Mir wollten immer Leute verraten, wer da alles dabei ist, aber ich wollte wirklich überrascht werden. Als ich dann das erste Mal die Treppe im Werkroom runterging und „Hallo, hallo, hallo“ sagte, war ich platt, wie krass die da aufgefahren und abgeliefert haben. Wir müssen uns international nicht verstecken.
Nikita: Ich war auch überrascht, als ich zuerst in den Werkroom gelaufen bin. Ich bin ja eine der ältesten Queens und bringe eben viel Erfahrung mit, dachte ich. Und dann kommen plötzlich die anderen Queens um die Ecke und ich dachte: Alter Schwede, was ist das?
Barbie: Das ist halt auch nicht das, was man von Deutschland erwartet hätte. Die Leute gucken auf Deutschland, denken, das ist altbacken und sicher zu schwerfällig oder plump. Nicht besonders filigran, nicht … besonders eben.
Ist unser Ruf so schlimm?
Barbie: Ich arbeite ja noch im Make-up-Bereich, habe ständig mit Leuten aus den verschiedensten Ländern zu tun, und die denken schon oft: Das ist alles Sauerkrautland hier. Die sind schon überrascht, wenn sie das erste Mal in Berlin sind und sehen, wie cool die Stadt und die Leute sind. Und wer hätte gedacht, dass ich als Moderatorin ausgewählt werde, also eine dicke, nichtbinäre, HIV-positive Aktivistin? Das war schon ein krasser Move.
Ist das denn ein Thema in der Sendung? Also dein Gewicht und HIV?
Barbie: Natürlich spielen mein Gewicht oder mein HIV-Status keine Rolle für die Show, es geht ja um unsere Girls. Aber wir sprechen trotzdem auch über HIV und mehrgewichtige Körper.
Konntest du dich gut auf deine Rolle vorbereiten?
Barbie: Ich habe 20 Kilo abgenommen zur Vorbereitung. Und ich habe mir noch ein bisschen genauer angeschaut, wie RuPaul ein Snatch Game moderiert zum Beispiel, wo sie wann steht, aber ich wollte auch keine Imitation machen. Ich will ja ich bleiben, meine Sachen machen.
Kanntest du viele Queens von früher, Nikita?
Nikita: Ich kannte mehr als die Hälfte, glaube ich. Und die mich auch. Neu waren für mich natürlich auch die aus Österreich und der Schweiz. Aber es sind alles wunderbare Menschen, ich liebe alle.
Wie habt ihr die einzige AFAB-Frau im Cast empfangen?
Barbie: Na, Pandora ist ja nicht die erste AFAB-Queen („Assigned Female At Birth“, eine AFAB-Queen ist also eine biologische Frau, die sich als Dragqueen verkleidet, Anm. d. Red.), insgesamt mit allen internationalen „Drag Race“-Ausgaben ist sie die dritte. Und das finde ich großartig. Und vielleicht auch wieder ein bisschen unerwartet, ausgerechnet im deutschen Franchise. Ich war sehr happy, dass keine der anderen Queens im Cast Pandora anders behandelt hat. Da gab es ja durchaus auch sehr laute Diskussionen vorher, ob Cis-Frauen einen Platz haben bei „Drag Race“. Ich finde, Drag ist für alle da.
Darfst du wirklich die letzte Entscheidung treffen, so wie RuPaul in der amerikanischen Version?
Barbie: Nein, die Lipsyncs zum Beispiel entscheiden wir alle zusammen, ganz demokratisch. Aber es gab viele Sachen, wo ich dann einfach sagen konnte: Okay, das will ich aber jetzt so machen, oder ich will, dass wir das so sagen, oder das machen wir einfach gar nicht.
Nikita, hast du Vorbilder, denen du nacheiferst?
Nikita: Also ich finde ja die alten Klassiker toll: Detox, Manila Luzon, Raven, Roxy Andrews. Lustig müssen sie sein, Crystal Versace finde ich geil.
Sind auch die dunklen Seiten des Nachtlebens Thema bei der Show? Jeder von uns kennt doch Leute, die unter die Räder gekommen sind.
Nikita: Auf jeden Fall, es geht oft um Gefühle. Manchmal war ich überrascht, wie sehr sich Menschen vor einer Kamera öffnen können. Manche haben ja sicher auch etwas Angst davor, was passiert, wenn das jetzt alle über dich wissen. Nein, ich habe jetzt nicht von mir gesprochen, aber so ganz allgemein.
Barbie: Klar, im Nachtleben geht es teilweise wild her und einige Leute schaffen dann den Absprung nicht mehr. Ich habe ja selber jahrzehntelang hart gefeiert, aber das liegt schon Jahre hinter mir. Drogen sind für mich mittlerweile echt uninteressant geworden und Neinsagen fällt mir sehr leicht. Aber da stecken auch einige Jahre Therapie dahinter. Ich finde das auch toll, dass wir eben bei „Drag Race“ Leute haben, die ganz offen mit ihrer Geschichte umgehen.
In Berlin sind ja sonst Dragqueens eher in Form von Trümmertunten bekannt, oder?
Barbie: Das ist ja jetzt echt Musik aus den 80ern, es gibt so viel anderes in Berlin mittlerweile. Wir haben so viele verschiedene Drag-Szenen. Zum Beispiel auch heute wieder sehr politische Gruppen wie die Queens against Borders, die superaktiv sind. Wir haben eine ganze Generation junger Queens, die nachgewachsen ist, die Drag von „Drag Race“ kennt und Look und Style eben auch eins zu eins nachzuahmen versucht. Und natürlich spielt die eher oldschoolige Travestie ja in ganz Deutschland auch eine Rolle, die man nicht ignorieren darf.
Wo kann ich denn in Berlin heute Drag erleben?
Barbie: Du kannst ins Tipsy Bear gehen, ins SchwuZ, im Theater des Westens gibt es freitags ab und zu „Ringelpiez“, und dann natürlich Nikitas Beach, seit acht Jahren am Hauptbahnhof.Habt ihr in Berlin einmal unangenehme Dinge erlebt?
Barbie: Also mir ist in Berlin tatsächlich noch nichts passiert. Ich komme aus der Nähe von Frankfurt, da gab es ständig auf die Mütze. Aber auch hier in Berlin, wenn ich unterwegs bin, vermeide ich ganz viel. Ich steige beispielsweise nicht besonders bunt angezogen in die U-Bahn. Ich bin mir der Gefahr sehr bewusst. Ich bin vielleicht auch manchmal übervorsichtig. Ich kenne Leute, die fahren immer in Drag mit den Öffentlichen und denen passiert nie irgendwas. Aber die Zahl der Übergriffe mit queerfeindlichem Hintergrund steigt leider seit Jahren rasant.
Nikita: Es kommt auch darauf an, wie du auftrittst, denke ich. Wenn ich jetzt als eine eingeschüchterte Person immer nach unten schaue, bin ich ein leichteres Angriffsziel.
Ist dir mal etwas passiert?
Nikita: Ohne Drag, ja. Damals beim Europacenter, wir kamen aus dem Club Puro, glaube ich, und dann haben uns sechs Jungen angegriffen. Einfach, weil wir schwul waren. Das war mein erster Übergriff, wo so Leute auf dich einprügeln. Und ich lag dann am Boden, so in mich gekrümmt, und dachte: Wie können Menschen so sein? Natürlich haben wir die Polizei gerufen, die waren auch sehr nett. Aber die Suche nach den Tätern wurde irgendwann eingestellt. Das ist jetzt so fünf oder sechs Jahre her.
Seid ihr vorbereitet auf das, was danach kommt, wenn die Staffeln draußen sind, Lob und Kritik?
Nikita: Ich muss sagen, ich hatte jetzt schon ein paar negative Kommentare gelesen und bei einem schrieb ich: Dankeschön. Weil ich irgendwie dachte, das gehört auch dazu. Aber Social Media war nicht wirklich mein Ding bisher, ich musste das richtig lernen und beschäftige mich jetzt öfter damit.
Barbie: Wie kann man sich auf etwas vorbereiten, von dem man nicht weiß, wie es laufen wird? Ich habe schon den einen oder anderen Shitstorm im Laufe meines Lebens gehabt. Insofern bin ich, was das angeht, ein gebranntes Kind. Was vielleicht auch ganz gut ist. Aber es tut ein bisschen mehr weh, wenn es aus den eigenen Reihen kommt.
Nikita: Irgendwas ist doch immer falsch, das Kleid oder der Blick in einer Szene … Ich setze mich da nicht unter Druck.
Barbie: Meistens sind das ja gesichtslose Menschen, die sich hinter einem anonymen Profil verstecken. Ich glaube, es ist was anderes, wenn jemand wirklich die Eier hat, zu sagen, das hier bin ich, das ist mein Name, und ich kritisiere das jetzt.
Sind eure Eltern stolz auf euch?
Barbie: Also mein Papa kommt zur Premiere. Der hat mich noch nie in Drag gesehen. Ich bin ganz aufgeregt.
Nikita: Bei mir kommen meine Mama, meine Schwester, mein Bruder. Also meine Eltern sind sehr stolz auf mich. Sie drücken es jetzt nicht wörtlich so aus, aber das Gefühl geben sie mir schon, ja.
Barbie: Neulich hab ich jemanden geschminkt und dann klingelt mein Handy. Ich sehe, mein Vater steht auf dem Display. Und ich merkte, dass ich so eine Panik bekam, dass er absagt. Aber er hat nur gefragt, ob er auch zur Party mitkommen soll. „Ich kreuze mal beides an“, sagte er dann. Und ich habe dann aufgelegt und sofort angefangen zu heulen. Selbst nach zig Jahren Therapie ist das immer noch ein Thema, also diese Angst, auch heute noch von einem geliebten Menschen abgelehnt zu werden und nicht akzeptiert zu werden. Das ist einfach noch ein wunder Punkt für viele von uns.