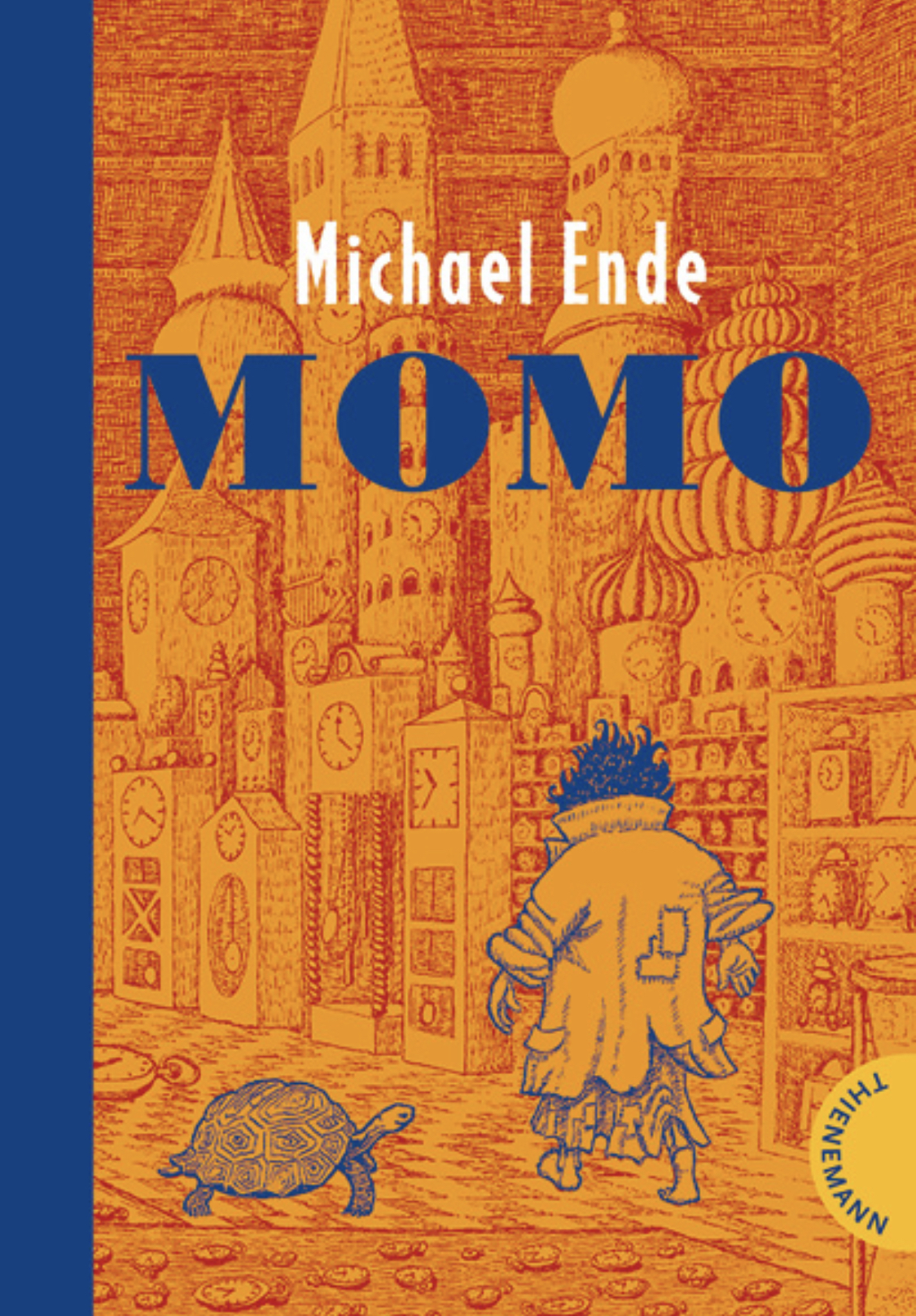Der Kopf stößt an die obere Seite des Sarges, die Füße liegen mit der Fläche auf der unteren Seite. Dieser Sarg hat, kein schöner Gedanke, wirklich genau meine Größe. Bevor er zuging, hatte ich die Arme parallel vor die Brust gelegt, ohne zu bedenken, dass diese Position später nicht mehr zu ändern sein würde. Der Sargdeckel liegt auf und verhindert jede Bewegung. Ein kleiner Spalt Luft bleibt. Sonst nichts.
Durch die Holzwand entferntes Rauschen eines Waldes, noch entfernter eine koreanische Schnellstraße im Süden von Seoul, ganz nah plötzlich Schritte im Wald, eine Glocke, das muss der Zeremonienmeister sein. Er läuft an den Särgen auf und ab.
So beginnt das Nachdenken. Über die Zeit, die bleibt. Und die Frage: Was mache ich hier?
Das Sterbe-Seminar heißt „Happy Dying“, seit zwölf Jahren veranstaltet es der koreanische Mönch Kim Giho, immer samstags in einem Tempel im Süden Seouls, direkt neben einem Waldstück auf einem Hügel. Die große Buddha-Statue ist eingerüstet, davor steht eine zweite in Gold. Im Gespräch zuvor hat der Mönch erzählt, was die Erfahrung bei Besuchern auslöst („Sie finden wieder eine Richtung im Leben“), warum es einen Sarg geben muss („Nur wer dem Tod nahe kommt, verliert die Angst vor ihm“) und wie es bei ihm angefangen hat: „Ich habe meditiert und plötzlich das Große gefunden.“ In holprigem Englisch sagt er: „The big one.“ Irgendetwas Großes also. Eine Antwort vielleicht?
Zuerst wird ein Trauerfoto erstellt
Im Sarg habe ich nicht das Gefühl, hier etwas Großes zu finden. Es ist einfach verdammt eng. In den fünf Stunden vorher habe ich genug über das Ende nachgedacht. Es begann mit einem Handyfoto von mir, das eine ältere Frau gemacht und ausgedruckt hat, mit einer schwarzen Schärpe an den Rändern. Es ist ein Trauerfoto, manch andere Teilnehmer versuchten ein Lächeln, aber der schwarze Rand überschattet jeden Gesichtsausdruck: Alles ist vorbei.
Die Damen legen die Fotos der „Toten“ ordentlich auf den Tisch, daneben kann jeder und jede sich seinen Grabspruch aufschreiben. Es sind 18 Teilnehmerinnen und 12 Männer, die koreanische Gesellschaft ist hier versammelt. Darunter eine alte Frau am Stock, eine ältere im Abendkleid, ein 40-Jähriger gekleidet wie für eine Bergwanderung, ein junges Pärchen.
Kann dieses Sprechen über den Tod nicht auch riskant sein? Nein, sagt Kim Giho, riskant sei hier gar nichts. Und Menschen mit einem schwachen Herz dürften die Sargzeremonie am Ende ohnehin nicht mitmachen.
Korea hat einen besonderen Umgang mit dem Tod. Vor allem Suizid gilt bei Problemen als gesellschaftlich akzeptiert. Südkorea führt seit elf Jahren die Liste der Selbstmorde in der OECD an. Insgesamt 14.427 waren es im Jahr 2013, das entspricht rund 40 Menschen am Tag.
Eine der Brücken über den Hangang in Seoul heißt im Volksmund „Brücke des Todes“, denn von ihr stürzen sich besonders viele Menschen. Die Stadt reagierte, indem sie sie offiziell die „Brücke des Lebens“ nannte und am Geländer Lautsprecher anbrachte, die Fußgänger daran erinnern, das Leben zu schätzen und vielleicht noch einmal die Eltern anzurufen. Zugleich forderten in diesem Jahr nicht wenige Demonstranten den Kapitän der untergegangenen „Sewol“-Fähre auf, sich das Leben zu nehmen. Beim Unglück waren mehr als 300 Menschen gestorben, die meisten Kinder.
Im Seminar erklärt Kim Giho den Tod anhand von Filmausschnitten. Er zeigt einen Teil aus „The Impossible“ mit Ewan McGregor, der in der Szene beinahe seine Familie im Tsunami in Thailand verliert. „Familie ist das wichtigste überhaupt“, schärft Kim Giho den Zuhörern ein. „Sie trauert am meisten.“
Er zeigt Patrick Swayze, wie er als „Ghost“ in ein gleißendes Licht geht. „Sterben ist etwas Friedliches, haben Sie keine Angst.“
Am Ende des Vortrags zeigt er einen Dokumentarfilm über einen sterbenden Koreaner in Palliativbehandlung. Sein Todeskampf ist nur schwer zu ertragen. Röcheln, Husten, weinende Verwandte. Auch viele der Teilnehmer weinen. Spätestens hier nimmt Kim sie mit auf seine Reise in das, was danach kommt. Er sagt, er selbst hat viele Patienten beim Sterben betreut, bevor er begann, diese Seminare zu geben.
Eine Botschaft wird an die Wand geworfen: „Wir sind nur eine Energie, die weiterwandert, wenn wir sterben.“ Ein Schniefen geht durch den Raum, die älteren Damen bringen Taschentücher an die Tische.
Das mit der Energie ist natürlich etwas, das man schon gehört hat. Buddhismus, Daoismus, Leben ist Leiden. Und doch ist Sterben ein sehr persönlicher Prozess. Auch ein sehr einsamer. Erst im Sarg wird klar, warum Kim zu Beginn des Nachmittags die drei Paare, die gekommen waren, getrennt gesetzt hat. „Sterben muss jeder allein.“ Im Sarg ist kein Platz für jemand zweiten.
Ein paar Särge weiter weint leise eine Frauenstimme. Dann ein Flüstern. Kim kümmert sich. Das Leben da draußen auf den Straßen mit seinen Millionen kleinen Mobiltelefonbildschirmen und großen Straßenbildschirmen, mit den Hochhäusern und Betrunkenen vor kleinen Eckkneipen ist nur noch gedämpft und weit entfernt zu hören.
„In Seoul geht das Leben so schnell vorbei und die Menschen merken gar nicht, wie wichtig Zeit ist“, sagt Kim Giho. Deswegen seien Koreaner wohl empfänglicher für so ein Seminar. Nicht einmal Entschleunigung hilft hier noch, sondern Entzug von allem. Im Sarg wirkt noch dieser Satz nach: „Du bist kein Statist in deinem Leben, du bist der Hauptdarsteller. Verhalte dich in Zukunft auch so.“
Im Seminar stellt Kim Giho Fragen an die Besucher, sie füllen sie aus, zum Teil lesen sie die Antworten vor allen vor: Welche Menschen haben Dich bis heute beeinflusst? Was hast Du bisher erreicht? Was würdest Du tun, wenn Du noch sechs Wochen zu leben hättest? Worauf bist Du stolz? Wer ist über Deinen Tod am traurigsten? Wann warst Du zuletzt so richtig glücklich? Oder die wichtigste Frage: Welche Lehre hast Du bisher aus dem Leben mitgenommen?
Immer wieder melden sich Teilnehmer und erzählen aus ihrem Leben, von ihrem autistischen Kind, vom verstorbenen Vater, den entfremdeten Geschwistern. Kim Guan Yeol, 31, sagt, er hatte schon einmal den Lebenswillen verloren und fügt schnell hinzu, er wollte sich aber nicht umbringen. Nur sei dieser eine Schicksalsschlag sehr schwer gewesen. Auch seine Freundin habe ihm da nicht mehr hinaushelfen können. Sie ist mitgekommen zu diesem Seminar.
Eine ältere Dame sagt, sie habe erst hier bei „Happy Dying“ gelernt, dass sie ihr Erbe regeln muss, es sei doch alles so unsicher heutzutage. Die Koreanerin wohnt seit Jahren in Los Angeles, dort gehe auch alles so schnell und alle schauten nur auf das Geld, sagt sie.
Die Menschen die hierherkommen, wollen Bilanz ziehen, wollen das Nachdenken über den Tod, das Ende in den Griff bekommen. Religion spiele keine Rolle, das bestätigen die Teilnehmer. Gestorben wird weltweit.
Nur hier in Korea und in Japan haben sich diese Seminare so entwickelt, als ob der Tod – verbunden auch hier mit vielen Ritualen –, als ob sich durch diese Summe der Rituale schon eine Erkenntnis ergibt. Vielleicht geht es nur um das Nachdenken darüber? Am Ende des Seminars haben alle die Gelegenheit, einen letzten Brief an die Wichtigsten zu schreiben. Die Familie, die Freunde, alle lesen ihren Brief vor, die meisten entschuldigen sich, dass sie ihre Liebe nicht genug gezeigt haben. Das Weinen vor Fremden ist nach diesen vier Stunden schon nicht mehr ungewöhnlich. Ich lese meinen Brief auf Deutsch vor.
„Ihr Lieben“, geht er los, und ich bedanke mich für das Abenteuer der letzten 35 Jahre. Der Brief entschuldigt sich auch für Dinge. Aber am Ende des Briefes zitiere ich Kim Giho, weil er gesagt hatte, Tod sei auch Neubeginn. Ich schreibe: „Nicht traurig sein. Hab Euch lieb.“ Als ich den Zettel zu Ende vorgelesen habe, sehe ich, dass ich jede Zeile von links bis rechts vollgeschrieben habe. So wie ich früher eine SMS auch immer bis genau 160 Zeichen geschrieben habe. Das Maximum herausholen. Sollte das auf meinem Grab stehen?
Als ich an den Tischen vorbeigehe, sehe ich, dass die Koreaner immer nur ihren Namen auf den Grabstein schrieben. Mit dem Datum. Auch die Gräber sind in Korea schlicht gestaltet: Ein kleiner Grashügel, ein Stein mit Namen und Daten. Alles andere wäre hier vielleicht eitel. Im Sarg mit dem Luftschlitz werden die Dinge plötzlich furchtbar egal. Energie, weiterziehen, wir sind nur Gäste, auch diese Theorien werden egal. Es ist ja nichts mehr.
Die 20 Minuten im Sarg fühlten sich länger an. Als ich aus dem Sarg aufstehe, den Deckel zur Seite lege, habe ich keine Lust mehr, noch mehr von Kim Giho und seinen Weisheiten zu hören. Er beginnt auch, ein bisschen anstrengend zu werden, sagt, er wolle die Welt erleuchten, so wie „Neo“ im Film „Matrix“ die Menschen erleuchten wollte. Sein E-Mail-Name sei deshalb auch „Neo“. Wir seien nur Hologramme, sagt er und macht mir ein bisschen Angst.
Bevor sich die Gruppe trennt, lässt er sich noch dreimal alle gemeinsam zusammenkommen, er lächelt – das hat er nicht oft getan an diesem Tag –, und alle rufen dieses eine Wort laut: „Hwaiting! Hwaiting! Hwaiting!“ Dieser koreanische Ausdruck wird oft verwendet im Alltag hier im Land, vor Prüfungen, oder morgens, wenn man keine Lust hat, auf Arbeit zu gehen. Er geht auf ein englisches Lehnwort zurück: „Fighting!“, Kämpfen.
Die meisten sehen gelöst aus. Die, die vorhin weinten, lachen besonders laut. „Happy“ sind sie wohl jetzt, weil es vorbei ist, weil irgendwo ein Familienmitglied jetzt bald einen Anruf bekommt. Die kalifornische Koreanerin fliegt morgen zurück nach Amerika. Kim Guan Yeol geht jetzt mit seiner Freundin etwas essen. In den 50.000 Won (rund 35 Euro) Seminargebühr waren keine Snacks enthalten. Draußen vor dem Buddha rauscht der Verkehr und blinken die Bildschirme vom teuren Stadtteil Gangnam. Vielleicht geht es ja leichter, jetzt, mit dem Sarg im Herzen: Hwaiting.